#1: Die Klamotten-Frage
Wer zittert, fährt schlechter. Auf der anderen Seite: Wer als Winterfahrer so dicht eingepackt ist, dass nach dem Aufsitzen nicht einmal der Kopf gedreht werden kann, gewinnt auch keinen Blumentopf. In beiden Fällen wird die Reaktionsgeschwindigkeit in Mitleidenschaft gezogen.
Besonders exponiert im Winter: die Gashand. Wie die Kupplungshand liegt sie dauerhaft im Fahrtwind, bei Regen auch im Selbigen, kann aber nicht mal so kurz zum Aufwärmen in Motornähe gehalten werden. Vielleicht ein wenig an der Ampel, aber damit hat sich’s schon. Schlimmer noch: Während flüssiges Kuppeln nicht immer Not tut und verzögertes Angasen im Winter durchaus Vorteile besitzen kann, ist die Gashand gleichzeitig auch die Bremshand – und eine verzögerte oder grobmotorische Bremsung durch abgefrorene klamme Griffel ist das Letzte, was man sich wünscht.

Womit klar ist, dass einer warmen Hand im Winter fundamentale Bedeutung zukommt. Und die lässt sich auf verschiedene Weise zumindest in Teilen realisieren – immer auch abhängig davon, wie viele Kilometer man am Stück abzureißen gedenkt:
- Textilhandschuhe: Kaltes Leder kühlt die Griffel schneller aus als Textilhandschuhe, weshalb sie an kühlen Tagen die bessere Wahl sind. Auch behalten sie ihre Beweglichkeit, während Lederhandschuhe unter Kälte härter, steifer und unbeweglicher werden.
- Fette Winterhandschuhe: Winterhandschuhe schützen die Hände ähnlich wie Leder vor kaltem Fahrtwind, halten darüber hinaus aber dank innerer Fütterung die Grundtemperatur über einen längeren Zeitraum. Der Nachteil liegt, wie bereits angedeutet, im negativen Einfluss auf die Bewegungsfreiheit.
- Unterziehhandschuhe: Bereits ein einfacher, dünner Unterziehhandschuh sorgt für ein Wärmepolster nach Fahrtantritt, egal, ob als eigentlicher Handschuh ein Leder- oder Textilkollege drüber gestülpt wird. Je nach zu bewältigender Strecke, bspw. bei Pendlern, kann dies folglich bereits ausreichen, die im Sommer genutzten Handschuhe im Winter beizubehalten. Auch beeinflussen sie die Bewegungsfreiheit nicht so stark wie dicke Winterhandschuhe.
- Griffheizungen: Als praktikable technische Lösung für das Winter-Abfrierproblem sind vom Bordnetz gespeiste Griffheizungen. Sie sind zu unterschiedlich hohen Preisen zu bekommen, erfordern allerdings nicht selten schraubtechnisches Geschick beim Anbau. Nachteilig ist ferner die simple Tatsache, dass die Hände nur von unten erwärmt werden, während die obige Seite nach wie vor dem kalten Wind ausgesetzt bleibt. Auch wird so manches Modell direkt an der Batterie angeschlossen und vergisst man dann, beim Abstellen die Heizung abzuschalten, wird sie über Nacht die Batterie leersaugen.
- Abweiser: Potthässlich, ab funktionell sind die sogenannten Handprotektoren, rundlich gehaltene Halbschalen vor Kupplungs- und Bremshebel, die neben Dreck und Wasser auch den Fahrtwind abhalten und die Außenseiten der Hände damit eine Zeitlang über Wasser halten können.
Weiter oben am Körper ist darauf zu achten, dass Hals und Gesicht bestmöglich abgedeckt werden. Dort, wo die Jacke endet und der Helm noch nicht beginnt, kann man mit dicken Halstüchern, einer Halskrause oder einem Brustschutz nachhelfen, während auf dem Kopf selbst besser ein Integralhelm thront und die Halbschale auf dem Kleiderschrank den Winter verbringen sollte. Das Visier bleibt geschlossen, auch wenn es keine Insekten mehr hagelt, und beschlägt es, hilft ein Pinlock (das feuchtigkeitsabsorbierende Anti-Beschlag-Visier im Inneren des Helmvisiers) oder ein Antibeschlagspray, das vor der Fahrt aufgesprüht wird.

Am anderen Ende des Körpers, also an den Füßen, pappe Funktionssocken über Zehen und Hacke, die sowohl Wärme speichern als auch Feuchtigkeit abtransportieren können. Dicke Baumwollsocken kurbeln nur die Schweißproduktion an und bunkern das Zeug obendrein für schlechte Zeiten. Je nach Schuhwerk steht man dann relativ schnell im Wasser, was dem Wärmegefühl nicht gerade entgegenkommt.
Auf der anderen Seite: Wer täglich nur ein paar Kilometer pendelt, benötigt keine teuren Funktionsklamotten. Nicht an den Füßen und auch nicht über dem Rest des Körpers. Im Zweifel lässt sich im Winter sogar ein paar Minuten mit der Lederkombi fahren, vielleicht noch mit einer Regenkombi als Überzug.
Für längere Ausfahrten empfehlen sich hingegen Textilkombis und was Warmes drunter. Dann ist die erste Regel das Zwiebelprinzip: Eine Lage Funktionsunterwäsche plus eine Reservelage gleicher Qualität oben drüber. Einfache Baumwoll-Unterwäsche hält zwar ebenfalls warm, speichert aber Feuchtigkeit – und die wirst du genügend produzieren, wenn du mehrere Lagen Kleidung trägst. Etwas, was man bitter bereut, wenn man im kalten Wind steht …
#2: Die Grip-Frage
Wer im Winter die Füße vorm Ofen hoch legt, kommt wahrscheinlich am besten durch die elende Zeit, die auch durch Weihnachten und Sylvester nicht wirklich besser wird. Immerhin: Man kann am Bike schrauben und sich so über die Runden bringen, bis der Frühling wieder lacht.
Wer allerdings gezwungen ist, auch an kalten und nassen Tagen mit zwei Rädern auf die Straße zu müssen (oder wer es sogar mag), dem seien ein paar Tipps mit auf dem Weg gegeben, denn Asphalt im Winter ist anders zu sehen als im Sommer. OK, in beiden Fällen ist er entweder trocken oder nass, im Herbst und Winter legt er aber eine Schippe drauf und probiert verschiedene neue Varianten aus:
- Blätter auf dem Asphalt: Blätter sind üble Gesellen. An trockenen Tagen machen sie viel Spaß, wenn man durch sie hindurchfegen kann, an Regen- oder Nebeltagen rotten sie sich hingegen zusammen und bilden dank der Feuchtigkeit eine schmierseifenähnliche Oberfläche, die nur darauf wartet, einen unvorsichtigen Kurvenräuber zu Fall zu bringen. Wollen wir alle nicht. Deshalb umfahrt die Brüder nach Möglichkeit oder fahrt langsam und möglichst gerade drüber.
- Eis auf dem Asphalt: Schimmernde, glitzernde Stellen auf dem Asphalt deuten auf Eisflächen hin, mit denen man nicht nur bei Bodenfrost rechnen sollte, da sie an exponierten Stellen bereits weit vor echten Minustemperaturen entstehen können.
- Regen auf dem Asphalt: Der Regen im Herbst und Winter fällt insbesondere im ländlichen Bereich oft auf jede Menge liegengebliebenen Dreck aus Feldarbeiten und verwaisten Baustellen. Im Ergebnis wird die Fahrbahnoberfläche an diesen Stellen noch eine Portion rutschiger. Übel sind auch die kleineren ‚Regenbäche‘, die quer und manchmal auch schräge über die Fahrbahn verlaufen und selbst dann noch Wasser führen, wenn ein Regenguss längst aufgehört hat. Werden diese Wasserläufe zu schräge oder zu schnell überfahren, können auch gut profilierte Reifen wegschwimmen. Ganz abgesehen davon, dass sie wegen ihrer dünnen Oberflächenschicht bei entsprechenden Temperaturen schnell vereisen.

#3: Die Reifen-Frage
Eine Winterreifenpflicht für Motorräder gibt es in Deutschland seit 2017 nicht mehr. Dennoch sollte man sich mit seinen Sommerreifen nicht so auf den Straßen bewegen, als herrschten 20 Grad Plus. Im Gegenteil. Bei winterlichen Witterungsverhältnissen kann der für eine sichere Fahrt notwendige Mindestreibungswert sehr schnell unterschritten und das Unfallrisiko drastisch erhöht werden. Und das gilt nicht nur für Sportreifen mit minimaler Profilierung, sondern auch für normale Straßen- oder Tourenbereifungen. Die wenigsten fahren sich bei kalten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sicher, weil sie in aller Regel aus harten Gummimischungen bestehen, die wenig walken und nur langsam Temperatur aufbauen. Selbst dann nicht, wenn man den Reifendruck etwas senkt, in der Hoffnung, damit eine größere Auflagenfläche zu schaffen, die für mehr Grip sorgen soll.
Hinsichtlich des Reifendrucks gilt sogar eher das Gegenteil: Mit den kälteren Temperaturen draußen fällt auch der Reifendruck ab. Wurde bspw. am letzten warmen Tag der Reifen auf den vorgeschriebenen Wert gebracht, ist er für Ausfahrten bei kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt zu niedrig und sollte stehenden Fußes wieder auf den vom Hersteller vorgesehenen Normwert gebracht werden. Damit kommt er auch schneller auf Temperatur und die wiederum ist gut für den Grip.
#4: Die Putz-Frage
Dass der Streudienst an Frosttagen die Straßen weniger gefährlich macht, ist eine gute Sache. Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass die verstreuten Mischungen aus Sand und Salz nicht nur für neue Dreckkrusten sorgen, sondern die salzigen Komponenten auch für umfassende Korrosionsattacken verantwortlich sind. Salz frisst sich durch Gummidichtungen, elektrischen Leitungen und Rad- sowie Schwingenlager und breitet sich so nebenbei auf den Krümmern aus und macht sie stumpf und unansehnlich. Übrigens auch an trockenen Tagen, denn das Salz verschwindet nicht vom Fahrbahnbelag, nur weil die Sonne scheint. Abhilfe schafft eine möglichst sofortige Wäsche gleich nach der Ausfahrt. Und das auch noch gründlich und mit kaltem Wasser, da warmes die schädliche Arbeit des Salzes unterstützt und fördert.
Quellen
Vielleicht auch interessant:
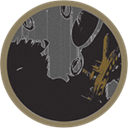
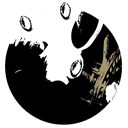



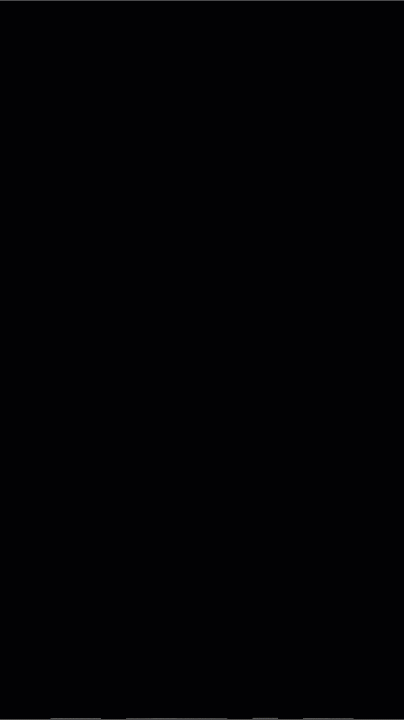

Kommentarfunktion deaktiviert